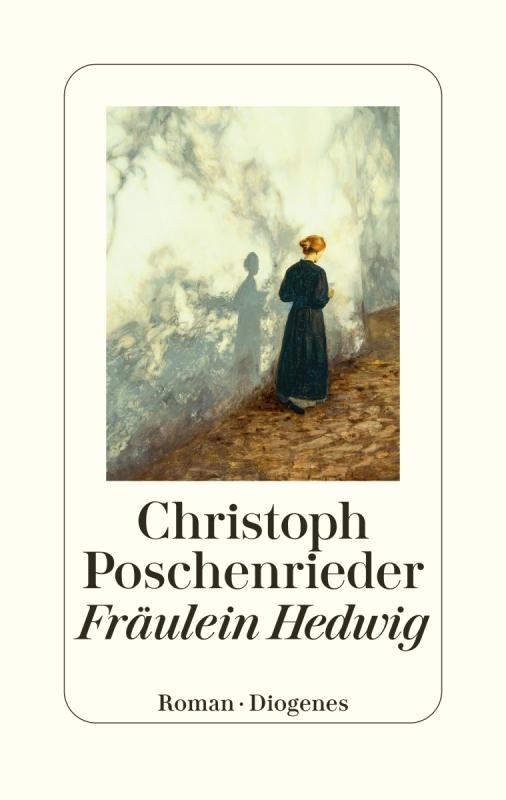Wenn die Stille schreit
Schon auf den ersten Seiten fühlt sich dieses Buch an wie ein leises Grummeln im Ohr — ungefähr so, als würde jemand im Nebenzimmer einen alten Schrank aufmachen und vergessene Geschichten herausstauben. ...
Schon auf den ersten Seiten fühlt sich dieses Buch an wie ein leises Grummeln im Ohr — ungefähr so, als würde jemand im Nebenzimmer einen alten Schrank aufmachen und vergessene Geschichten herausstauben. Hedwig ist keine Heldin im klassischen Sinn; sie ist eine Frau, die in den Ritzen der Zeit steckt, und genau das macht sie so elektrisierend. Christoph Poschenrieder beschreibt ihr Leben als Grundschullehrerin auf dem Land mit einer Beobachtungsgabe, die gleichzeitig zärtlich und messerscharf ist. Da ist dieses ständige Missverstehen: der Pfarrer, der Arzt, die Familie — alle haben ihre Diagnose parat, aber niemand hört wirklich zu. Das schmerzt. Und ja, manchmal muss man schlucken, weil die stille Wucht der Szenen einen erwischt, wenn man gerade denkt, man hätte den Ton erfasst.
Die Sprache ist unaufgeregt, aber nie kalt; sie hat diese trockenen, fast ironischen Spitzen, die mich lächeln lassen mussten, obwohl mir das Herz schwer wurde. Kleine Alltagsdetails — ein Schulranzen, ein verstaubtes Muster im Tapetenstoff, eine Telefonstimme — werden zu Fenstern in Hedwigs Innenwelt. Besonders stark: wie die Geschichte die Zeitenwende ins Bild setzt, ohne kitschig zu werden. Dann kommt die finstere Wendung unter der NS-Diktatur, und plötzlich wird aus dem Familiendrama ein Riesenproblem der Ohnmacht. Gradlinig erzählt, doch mit überraschenden Seitenblicken auf menschliche Verletzbarkeit.
Kurz gesagt: kein Wohlfühlbuch, aber eines, das nachklingt. Wer Sprache mag, die nicht laut sein muss, und Figuren, die innerlich kämpfen, findet hier einen Roman, der beides zusammenbringt — Humor, der aus Bitterkeit wächst, und Momente von echter Traurigkeit. Für mich: unbedingt lesen.