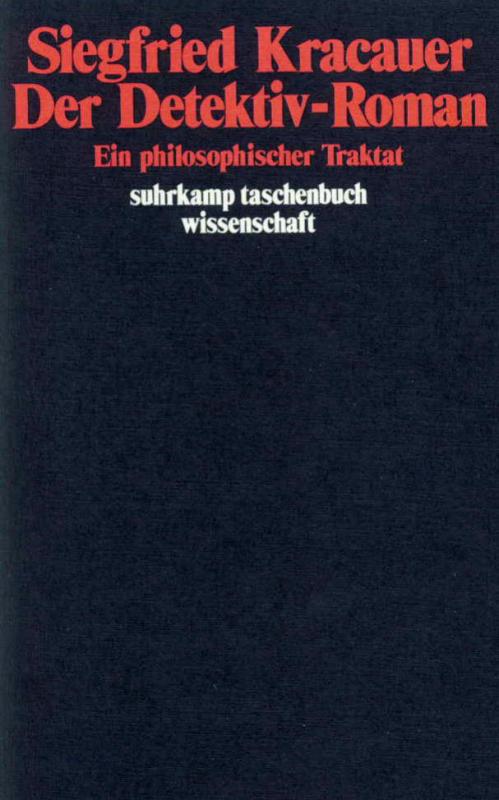Die Flucht des Stofflichen vor dem Zusammenhalt (105)
Ernst Bloch, Kracauer und Brecht haben jeweils das Bedürfnis verspürt, sich zu Kriminalroman und Detektiv-Geschichte ausführlicher zu äußern, aber nur bei Krac ist daraus ein ganzes Buch geworden - der ...
Ernst Bloch, Kracauer und Brecht haben jeweils das Bedürfnis verspürt, sich zu Kriminalroman und Detektiv-Geschichte ausführlicher zu äußern, aber nur bei Krac ist daraus ein ganzes Buch geworden - der vorliegende, recht schmale „philosophische Traktat“ mit zehn Kapiteln: „Beendet: 15. Februar 1925“. Aus dem Vergleich mit Brecht und Bloch, der beim Detektivroman ebenfalls zum Mittel der „Philosophischen Ansicht“ gegriffen hat (Lit. Aufsätze, stw 558, 242-263) und wahrlich weit hergeholte Artefakte aufbot, sollten die Krac´schen Eigenheiten deutlicher zum Vorschein kommen. Nur Brecht, scheint es, hatte das Zeug zum Bodenständigen und war besser in der Lage, konkrete Angaben zum Plotgeschehen beizusteuern (Ges. Werke Bd.19, 450ff): „Mord im Bibliothekszimmer eines lordlichen Landsitzes“; „Da ist ein Leichnam. Die Uhr ist zerbrochen und zeigt auf zwei Uhr. Die Haushälterin hat eine gesunde Tante. Der Himmel war in dieser Nach bewölkt. Und so weiter und so weiter.“ (450-52) Bei einer „philosophischen Betrachtung“ fallen solche Konkretionen offenbar durch den Rost. Bloch denkt zuerst an den Leser - „persönlich gut gesichert und ruhevoll in gefährliche Dinge vertieft, die flach sind.“ (242) Dann geht es recht stramm vom Pariser Juwelier und Meuchelmörder (1819) zu Poes hinterhältigem Orang-Utan (1841), zur „Junggesellenbude in der Bakerstreet“ und zur „völlig unkriminalistischen Anfangslehre Hegels“ (259) - „einziges Thema ist das Herausfinden eines bereits Geschehenen ante rem“ (254) und die Stoßrichtung sei auch immer klar - „Draperieverdacht, Illusionsverdacht: Gegen all das Idealische oder Biedere der Oberfläche, das zu schön oder zu bequem ist, um wahr zu sein.“ (253) An dieser Stelle übernimmt Krac den Staffelstab, verschärft aber Gangart und Tempo, wenn „der Detektiv das zwischen den Menschen vergrabene Geheimnis aufdeckt“, mehr noch - „das Geheimnis der entwirklichten Gesellschaft und ihrer substanzlosen Marionetten“ werde „im ästhetischen Medium“ des Romans gelüftet. (23) Wie solches in einem „im Äußerlichen sich erschöpfenden Handlungsgefüge“ (34) möglich sein soll, ist aber ebenso unklar wie das parallele Auftauchen von „Marionetten der Ratio“ (41) bzw. von „Figuranten der Ratio“ (53), etwa im „Urnebel des Hotelvestibüls“ (50), wo „der ganz zu sich abgeirrte Intellekt“ (44) einem „Gehege der genaueren Determinationen“ (70) ebenso ausgesetzt ist wie der „Bedeutungsschwere des Dinghaften“ (125). Brecht hätte das wohl „höchst kompliziert“ gefunden und sich beim Detektiv eher „an die Arbeitsweise unserer Physiker erinnert“ gefühlt, und zwar auf den Spuren des Kausalnexus. (451f,455) Das Rätselraten in die Nähe der Kreuzworträtsel zu rücken, wie Brecht das tut, wäre Krac sicher nicht in den Sinn gekommen, er wollte höher hinaus. Bei ihm ist der „Detektiv-Gott“ eine Art „säkularisierter Priester“ und nimmt „Verbrechern die Beichte ab“, aber nicht im Gotteshaus, sondern in einem Nachfolgeinstitut, in einer Hotelhalle, denn dort „zelebriert er (...) seine Messen, die gespenstischer sind als die schwarzen, weil sie der Verehrung des Indifferenten gelten.“ (54f) Diese neuen Priester der Aufdeckung leben immer noch zölibatär in einem „Junggesellentum a priori“ (59). Die Fitness ihrer Gegner, Widersacher und Bösewichte zwingt auch die detectivs zu „Taten ihrer Physis“ - am besten ist der Ermittler selber Sportsmann und „schießt wie ein Tiroler Wilddieb“. (100) Am Ende ist es also bei Krac mit Brechts bodenständigem Vergleich mit der Physikmethode nicht getan, denn das Gesamtgeschehen ist hier „ein Konglomerat von Tatsachenfetzen“ (102), „das zerpulverte Anschauungsmaterial“ sei bar jeder Kohärenz und die „Flucht des Stoffes vor dem Zusammenhang“ die eigentliche Herausforderung, was einem postmodernen und nachmetaphysischen Bewusstsein heutzutage nicht übel gefallen dürfte...
Michael Karl